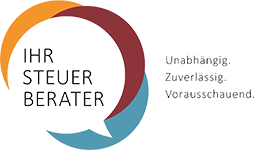Im Zusammenhang mit dem Leasing von betrieblich oder beruflich genutzten Pkw wurde zuweilen empfohlen, man möge mit dem Leasing im Dezember beginnen, eine hohe Sonderzahlung leisten und im Dezember - ausweislich einer Fahrtenbuchführung - viele Dienst- oder Geschäftsreisen unternehmen. So sollte die Leasingsonderzahlung bei Einnahmen-Überschussrechnern und bei Arbeitnehmern, die ihr eigenes Kfz dienstlich nutzen, nahezu vollständig abgezogen werden können - und zwar auch dann, wenn das Fahrzeug in den Folgejahren zu einem geringeren Umfang für Dienst- oder Geschäftsreisen genutzt wird. Allerdings steht das Modell schon seit langem auf dem Prüfstand der Finanzämter. Und nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs dürfte es nun weitestgehend obsolet sein.
Der BFH hat zunächst zu Fahrzeugen von Einnahmen-Überschussrechnern geurteilt, das heißt zu betrieblich genutzten Kfz. Dabei hat er dem Modell zumindest dann den Boden entzogen, wenn das geleaste Fahrzeug nicht dauerhaft, also über die gesamte Leasinglaufzeit, zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird (BFH-Urteil vom 12.3.2024, VIII R 1/21). Eine Leasingsonderzahlung, die für ein teilweise betrieblich genutztes Fahrzeug aufgewendet wird, ist danach den einzelnen Veranlagungszeiträumen während der Laufzeit des Leasingvertrags unabhängig vom Abfluss zuzuordnen. Nunmehr hat der BFH das so genannte Dezember-Leasing-Modell auch für Arbeitnehmer unter die Lupe genommen, das heißt für Nichtselbstständige, die einen Pkw leasen, um ihn umfassend für Auswärtstätigkeiten zu nutzen. Und auch hier wurde dem Modell die Grundlage genommen. Der BFH hat entschieden, dass eine Leasingsonderzahlung den einzelnen Veranlagungszeiträumen während der Laufzeit des Leasingvertrags zuzuordnen ist. Eine Zahlung im Dezember ist nicht sofort (in nahezu voller Höhe) abziehbar und erhöht den Kilometersatz auch nicht exorbitant für die Folgejahre. Die Zahlung ist vielmehr über die Leasinglaufzeit von beispielsweise 36 Monaten zu verteilen (BFH-Urteil vom 21.11.2024, VI R 9/22).
Es ging um folgenden Sachverhalt: Der Kläger ist ein angestellter Außendienstmitarbeiter. Im Dezember 2018 leaste er einen Pkw und leistete in diesem Monat eine Leasingsonderzahlung in Höhe von 15.000 Euro. Auch zahlte er die Fahrzeugzubehörkosten, Zusatzleistungen sowie einen Satz Reifen. Einschließlich dieser Kosten kam er für den Monat Dezember auf Gesamtkosten von 30.418 Euro. Er ermittelte eine Jahresfahrleistung von 32.717 km, wovon 1.025 Km auf den Monat Dezember 2018 und damit auf das neue Kfz entfielen. Der Kilometersatz betrug 0,93 Euro/km (30.418 : 32.717). Diesen - relativ hohen - Kilometersatz wandte der Kläger auch auf die Fahrten des Streitjahres 2019 an und machte - nach Abzug der Arbeitgebererstattung - Fahrtkosten für seine Außendiensttätigkeit in Höhe von 15.763 Euro als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt erkannte die Fahrtkosten der Höhe nach nicht an. Der für 2018 ermittelte Kilometersatz sei im Streitjahr nicht anwendbar, da sich die Verhältnisse gegenüber dem Vorjahr wesentlich geändert hätten. Mangels anderweitiger Berechnung für das Streitjahr sei nur der pauschale Kilometersatz von 0,30 Euro/km anzuwenden. Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt dem Grunde nach Recht. Der hohe Kilometersatz, der in 2018 ermittelt wurde, könne nicht auf die gesamte Leasingdauer angewendet werden. Vielmehr müssten die Gesamtaufwendungen des Kfz jährlich ermittelt und dabei insbesondere die Leasingsonderzahlung gleichmäßig auf die Leasingjahre verteilen werden. Diese Ermittlung muss die Vorinstanz nun nachholen.
Die Gesamtkosten sind periodengerecht den jeweiligen Nutzungszeiträumen zuzuordnen. Der Zuordnung zu den jährlichen Gesamtaufwendungen für die sonstigen beruflichen Fahrten (Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten) in den Folgejahren steht nicht entgegen, dass jeweils kein Abfluss der Zahlung erfolgt ist, da eine wertende Zuordnung der Leasingsonderzahlung zu erfolgen hat. Die vorstehenden Grundsätze sind auch auf andere (Voraus-)Zahlungen anzuwenden, die sich wirtschaftlich auf die Dauer des Leasingvertrags erstrecken. Da zu den jährlichen Gesamtaufwendungen für das Fahrzeug neben sämtlichen fixen Kosten zudem die AfA zählt, sind beispielsweise auch Aufwendungen für einen weiteren Satz Reifen nicht sofort im Jahr der Zahlung als Fahrzeugkosten zu berücksichtigen, sondern in Höhe der AfA in die jährlichen Gesamtaufwendungen für die sonstigen beruflichen Fahrten des jeweiligen Veranlagungszeitraums einzubeziehen.
Praxistipp:
In den Lohnsteuer-Richtlinien (R 9.5 LStR) heißt es bislang noch: Der Arbeitnehmer kann auf Grund der für einen Zeitraum von zwölf Monaten ermittelten Gesamtkosten für das von ihm gestellte Fahrzeug einen Kilometersatz errechnen, der so lange angesetzt werden darf, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern, zum Beispiel bis zum Ablauf des Abschreibungszeitraums oder bis zum Eintritt veränderter Leasingbelastungen. Insofern lässt es die Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen zu, dass ein einmal gefundener Kilometersatz prinzipiell auch in den Folgejahren angesetzt werden darf. Es ist davon auszugehen, dass diese Passage in den Richtlinien angesichts des BFH-Urteils geändert wird. Allerdings gehört zur Wahrheit dazu, dass viele Finanzämter auch bislang schon den Halbsatz "bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern" in ihrem Sinne ausgelegt haben und ohnehin häufig den zunächst gefundenen Kilometersatz angezweifelt haben.
gepostet: 21.04.2025